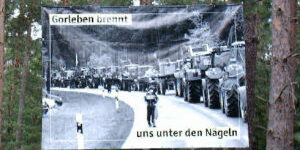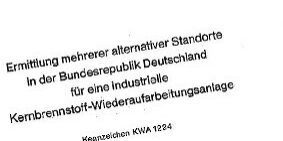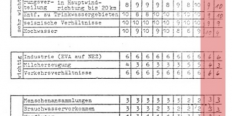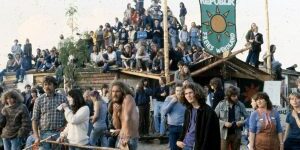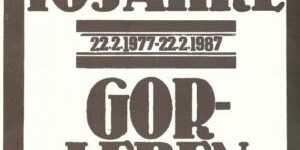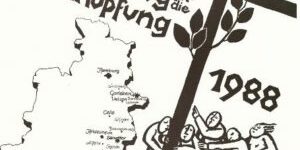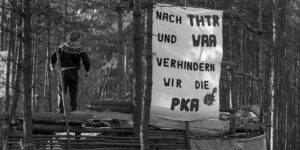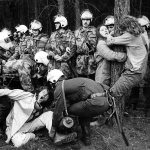

























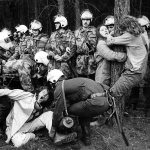










GORLEBEN-CHRONIK
Das Jahr 2015
Kulturelles Widerstandsfest
Tausende feiern im Sommer an den Atomanlagen, Erfolg vor dem Bundesverfassungsgericht: der "Kessel von Harlingen" war rechtswidrig.
Januar
01.01.2015
09.01.2015
16.01.2015
Im Zwischenlager Brunsbüttel befinden sich derzeit neun Castoren. Die Atomaufsicht in Schleswig-Holstein "duldet" die Lagerung bis Anfang 2018, weil es keine Alternative gibt.
Quelle: ENERGIE-CHRONIK, udo-leuschner.de
Februar
22.02.2015
März
14.03.2015
20.03.2015
Quelle: ENERGIE-CHRONIK, udo-leuschner.de
25.03.2015
April
Mitte April
Mitte April
Mai
Kulturelles Widerstandsfest
22.05.2015
Am Nachmittag überwinden einige hundert Besucher*innen den äußeren Begrenzungszaun des Endlagerbergwerks und fordern auf Transparenten den Rückbau der Anlage. Die Besetzungsaktion dauert bis in die frühen Morgenstunden an. Niedersachsens Innenminister Boris Pistorius spricht von einer "Gewaltorgie", "puren Polizeihass" und "blinde Zerstörungswut".
Juni
12.06.2015
"Harlinger Kessel" war rechtswidrig
25.06.2015
27.06.2015
Quelle: ENERGIE-CHRONIK, udo-leuschner.de
Juli
19.07.2015
Quelle: ENERGIE-CHRONIK, udo-leuschner.de
August
06.08.2015
September
01.09.2015
24.09.2015
Oktober
10.10.2015
Quelle: ENERGIE-CHRONIK, udo-leuschner.de
10.10.2015
23.10.2015
November
03.11.2015
15.11.2015
29.11.2015
Dezember
06.12.2015
08.12.2015
Quelle: ENERGIE-CHRONIK, udo-leuschner.de
28.12.2015
Die ganze Geschichte:

2001
Zwei Atommülltransporte rollen nach Gorleben, einer im März, ein zweiter im November. X-tausend Menschen stellen sich quer und WiderSetzen sich. Der Betonblock von Süschendorf zwingt den Castor zum Rückwärtsgang. Der Widerstand bekommt ein Archiv, die Bundestagsabgeordneten ein Denkmal, die „Gewissensruhe“.

2005
25 Jahre nach der „Republik Freies Wendland“ und 10 Jahre nach dem ersten Castortransport ist die Entsorgung des Atommülls weiter ungelöst. In die Debatte um die Entsorgung des Atommülls und die Zukunft der Atomenergie kommt Bewegung, die Veränderungssperre für den Salzstock wird verlängert. Container brennen, Bauern ziehen sich aus – und im November rollt der nächste Atommüllzug ins Zwischenlager.

2009
Brisante Enthüllungen: Gorleben wurde aus politischen Motiven zum Endlagerstandort. Seit Jahren wird nicht nur „erkundet“, sondern ein Endlager gebaurt. „Mal so richtig abschalten“ – ein Protest-Treck aus dem Wendland führt zu einer großen Demo gegen AKW-Laufzeitverlängerung nach Berlin. Kein Castortransport, seit Oktober finden jeden Sonntag Spaziergänge um das Bergwerk statt.

2024
Die BI fordert einen Transportestopp ins Fasslager und den Neubau der Zwischenlagerhalle aus Sicherheitsgründen, denn die Castoren werden noch lange hier bleiben müssen. Der „Rückbau“ des verhinderten Endlagers wird immer teurer, Ende November beginnt dann endlich das Zuschütten: 400.000to Salz kommen zurück unter die Erde. Ein Meilenstein.

1981
Gorleben-Hearing in Lüchow zum Bau des Zwischenlagers und massiver Protest gegen das AKW Brokdorf. Nach Bohrungen werden die Zweifel an der Eignung des Salzstock Gorleben für ein Endlager „größer, nicht kleiner“. Doch Gegner*innen des Projekts seien „Schreihälse, die bald der Geschichte angehören“, meinen Bundeskanzler Helmut Schmidt und Oppositionsführer Helmut Kohl.

2001
Zwei Atommülltransporte rollen nach Gorleben, einer im März, ein zweiter im November. X-tausend Menschen stellen sich quer und WiderSetzen sich. Der Betonblock von Süschendorf zwingt den Castor zum Rückwärtsgang. Der Widerstand bekommt ein Archiv, die Bundestagsabgeordneten ein Denkmal, die „Gewissensruhe“.

2005
25 Jahre nach der „Republik Freies Wendland“ und 10 Jahre nach dem ersten Castortransport ist die Entsorgung des Atommülls weiter ungelöst. In die Debatte um die Entsorgung des Atommülls und die Zukunft der Atomenergie kommt Bewegung, die Veränderungssperre für den Salzstock wird verlängert. Container brennen, Bauern ziehen sich aus – und im November rollt der nächste Atommüllzug ins Zwischenlager.

2009
Brisante Enthüllungen: Gorleben wurde aus politischen Motiven zum Endlagerstandort. Seit Jahren wird nicht nur „erkundet“, sondern ein Endlager gebaurt. „Mal so richtig abschalten“ – ein Protest-Treck aus dem Wendland führt zu einer großen Demo gegen AKW-Laufzeitverlängerung nach Berlin. Kein Castortransport, seit Oktober finden jeden Sonntag Spaziergänge um das Bergwerk statt.

2024
Die BI fordert einen Transportestopp ins Fasslager und den Neubau der Zwischenlagerhalle aus Sicherheitsgründen, denn die Castoren werden noch lange hier bleiben müssen. Der „Rückbau“ des verhinderten Endlagers wird immer teurer, Ende November beginnt dann endlich das Zuschütten: 400.000to Salz kommen zurück unter die Erde. Ein Meilenstein.

1981
Gorleben-Hearing in Lüchow zum Bau des Zwischenlagers und massiver Protest gegen das AKW Brokdorf. Nach Bohrungen werden die Zweifel an der Eignung des Salzstock Gorleben für ein Endlager „größer, nicht kleiner“. Doch Gegner*innen des Projekts seien „Schreihälse, die bald der Geschichte angehören“, meinen Bundeskanzler Helmut Schmidt und Oppositionsführer Helmut Kohl.